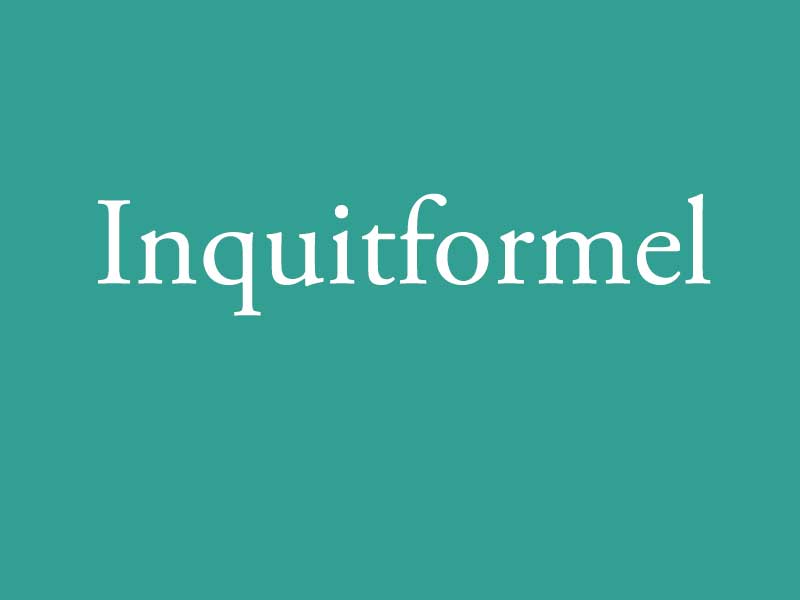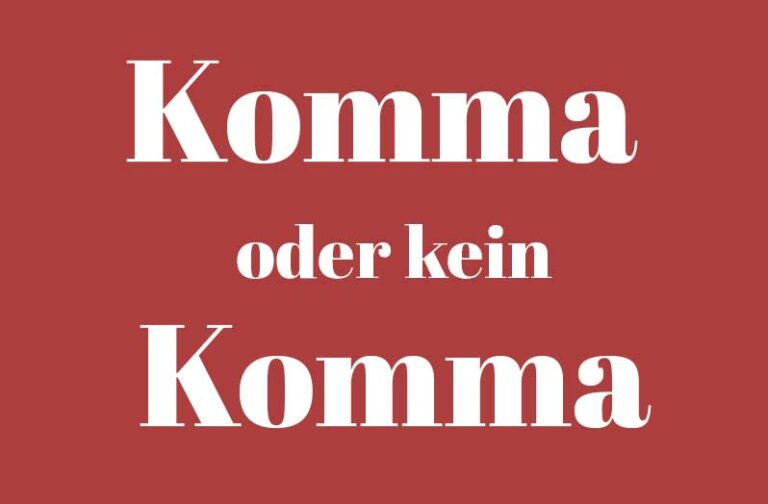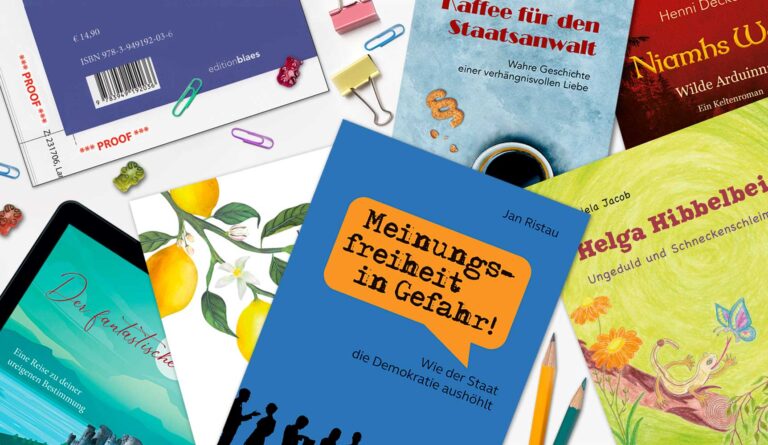Was ist denn eine Inquitformel?, wird sich so mancher Leser jetzt fragen. Hier die Antwort:
Die Inquitformel
Der Begriff „Inquitformel“ (kurz: Inquit) kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „er sagt“ bzw. „er sagte“.
Ein Inquit dient dazu, den Lesern oder Zuhörern klarzumachen, wer spricht und welche Emotionen in einem Gespräch oder Monolog zum Ausdruck kommen. Ein Inquit hilft dabei, die Atmosphäre einer Szene zu verstärken, Charaktere zu vertiefen und den Leser besser in die Handlung einzubinden. Auf diese Weise wird die Kommunikation zwischen den Figuren authentischer und emotionaler. Ein gut formuliertes Inquit ist ein wichtiges Werkzeug in der Literatur, um Dialoge effektiver und ansprechender zu gestalten.
Kurz gesagt: Die Inquitformel ist eine Satzkonstruktion, die den Beginn (oder das Ende) einer direkten Rede anzeigt. In der Regel besteht sie aus drei Elementen:
- Die direkte Rede, die in Anführungszeichen oder in einer anderen Weise hervorgehoben wird.
- Ein Verb der Rede oder des Sprechens: „sagte“, „rief“, „murmelte“, „flüsterte“ etc.
- Das Subjekt der Rede, das in der Regel eine Person ist.
„Ich gehe jetzt“, sagte Peter.
„Gute Idee“, schrie Anna.
Das Subjekt einer Inquitformel kann je nach Textumfeld durch ein Pronomen ersetzt werden: „Mach’s gut!“, sagte er.
Funktion und Zweck
Die Inquitformel erfüllt mehrere Zwecke. Sie dient dazu, den Lesern anzuzeigen, wer spricht, einen Dialog in die Handlung zu integrieren, Charaktere zu charakterisieren und die Stimmung oder Emotionen der Figuren zu vermitteln. Sie ist also ein wichtiges Werkzeug, um den Lesern Handlung und Charaktere zu erläutern.
Vielfalt
Autoren sollten auf die Vielfalt der Inquitformel achten. Also nicht nur Standardverben wie „sagte“, „fragte“ oder „antwortete“ verwenden, sondern die Inquits variieren, um den Schreibstil interessanter zu gestalten. Zum Beispiel: „stotterte“, „erklärte“, „stammelte“, „flüsterte“, „schrie“, „murmelte“ usw.
Weniger ist mehr
Die Inquitformel ermöglicht den Lesern, den Sprecher dem Text zuzuordnen. Dies sollte klar und konsistent sein. Man sollte vermeiden, den Leser zu verwirren, indem zu viele Inquitformeln verwendet werden. Zu wenige sind aber auch nicht gut, dann nämlich, wenn nicht eindeutig ist, wer spricht. In bestimmten Fällen kann es auch effektiver sein, den Sprecher anhand des Kontexts erkennen zu lassen.
Emotionen
Autoren sollten die Inquitformel nutzen, um die Emotionen und die Stimmung der Charaktere zu vermitteln. Ein Charakter kann beispielsweise etwas „freudig“ sagen oder „zornig“ antworten. Dies verdeutlicht die Tonlage des Gesprächs. Wobei es allerdings besser ist, die Gefühlslage der sprechenden Menschen direkt in der Erzählung darzustellen – und nicht in der Inquitformel. Kommt immer auf den Zusammenhang an.
Charaktere darstellen
Die Art und Weise, wie ein Charakter spricht und wie die Inquitformel verwendet wird, kann viel über die Persönlichkeit und die Beziehungen zwischen den Charakteren aussagen. Ein schüchterner und zurückhaltender Charakter spricht anders als ein selbstbewusster oder ausbrausender Charakter.
Atmosphäre/Situation
Die Inquitformel trägt auch dazu bei, die Atmosphäre und die aktuelle Situation der Geschichte zu vermitteln. Wenn die Handlung beispielsweise in einer düsteren, gruseligen Umgebung stattfindet, kann die passende Inquitformel dazu beitragen, diese Atmosphäre zu verstärken.
„Das war’s dann, Rudolf!“, rief Obermüller und richtete seine Waffe auf die schemenhafte Silhouette, die in einer dunklen Ecke stand. Der Regen prasselte auf das Pflaster, als ein Mann mit erhobenen Händen ins Licht der Straßenlaterne trat und mit einem gequälten Lächeln sagte: „Ich hatte gehofft, Sie würden kommen, Herr Kommissar.“
Grammatik und Satzstruktur
Autoren sollten die richtige Grammatik und Satzstruktur beachten, wenn sie Inquitformeln verwenden. Dies beinhaltet die Verwendung von korrekt gesetzten Anführungszeichen, Groß- und Kleinschreibung und die korrekte Platzierung der Inquitformel im Satz.
Fazit: Die Inquitformel ist ein wichtiges Werkzeug für Autoren, um Dialoge lebendig, verständlich und fesselnd zu gestalten.
Falsche Inquits
Inquits wie die folgenden kann man oft lesen, was aber nicht bedeutet, dass sie korrekt sind:
…“, seufzte sie.
…“, lächelte er.
…“, grinste sie.
Derartige Inquitformeln sind grammatikalisch falsch! Man kann Wörter weder seufzen noch lächeln noch grinsen. Wörter werden gesprochen! Die Erläuterung, wie gesprochen wird, fügt man korrekterweise hinzu.
Korrekt ist also:
„Na gut, ich werde mich entschuldigen“, sagte sie und seufzte.
„Das ist eine gute Entscheidung“, antwortete er und lächelte.
„Du hast leider recht“, sagte sie und grinste.
Ob man diese Formulierungen spannender formulieren könnte, steht auf einem anderen Blatt …