Öffentliche Lesungen – was viele nicht wissen und warum das teuer werden kann
Vor einigen Tagen habe ich eine überraschende Entdeckung gemacht:
In einer Pressemitteilung stieß ich auf die Ankündigung einer öffentlichen Veranstaltung, die nicht nur den Titel eines meiner Bücher trug, sondern in deren Rahmen auch zwei meiner Kurzgeschichten vorgelesen werden sollten. Beides, ohne dass ich informiert, geschweige denn gefragt bzw. um Genehmigung gebeten wurde.*
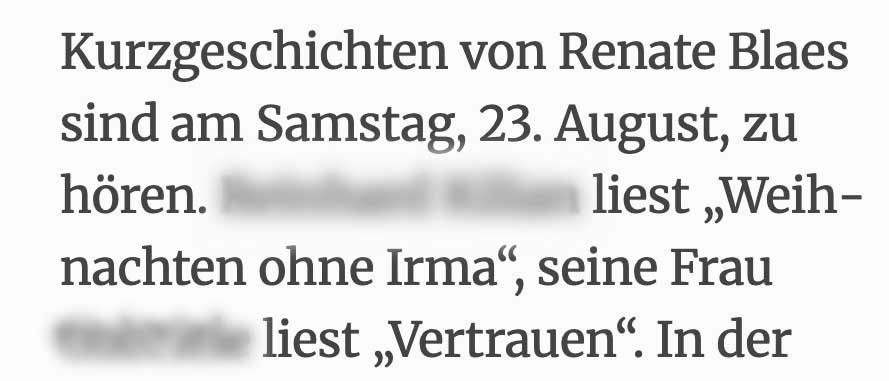
Das ist leider kein Einzelfall. Gerade bei Literaturveranstaltungen, die von Vereinen oder kleinen Kulturinitiativen organisiert werden, scheint die Annahme weitverbreitet zu sein: »Wir machen das ehrenamtlich, also dürfen wir einfach vorlesen.«
Das stimmt nicht! Im Gegenteil – es kann eine klare Urheberrechtsverletzung darstellen.
Hier die wichtigsten Punkte, die jeder kennen sollte:
Das Recht der öffentlichen Wiedergabe (§ 19 UrhG)
Das Urheberrechtsgesetz räumt dem Urheber das ausschließliche Recht ein, sein Werk öffentlich wiederzugeben.
Dazu gehört auch jede Form einer öffentlichen Lesung – egal, ob:
- Eintritt verlangt wird oder nicht,
- es in einer Bibliothek, einem Verein, einer Schule oder auf einem Stadtfest stattfindet,
- die Veranstaltung ehrenamtlich organisiert ist.
Öffentlich bedeutet: Jede Vorführung außerhalb eines rein privaten Rahmens, also alles, wo nicht nur Familie und enge Freunde anwesend sind.
Ohne Zustimmung des Urhebers ist eine Lesung daher unzulässig.
Zustimmungspflicht – auch bei kurzen Texten
Viele glauben, „ein paar Sätze“ oder „kurze Auszüge“ seien erlaubt.
Tatsächlich greift hier nur in sehr engen Fällen die Zitatregelung (§ 51 UrhG) – und nur dann, wenn der zitierte Text in ein eigenes Werk eingebettet ist und der Umfang des Zitats gerechtfertigt ist.
Eine reine Lesung, bei der der Text im Mittelpunkt steht, ist fast nie durch das Zitatrecht gedeckt – auch dann nicht, wenn es nur ein Auszug ist.
Namensnennung ist Pflicht (§ 13 UrhG)
Wird ein Werk öffentlich wiedergegeben, muss der Urheber genannt werden – in der Regel mit vollständigem Namen und vollständigem Werktitel.
Fehlt dieser Hinweis, wird das Urheberpersönlichkeitsrecht verletzt.
Titel können geschützt sein (§ 5 MarkenG)
Nicht nur der Text des Buchinhalts, auch der Titel eines Werkes kann geschützt sein.
Wird ein identischer oder sehr ähnlicher Titel für eine Veranstaltung, ein anderes Buch oder ein anderes Medium verwendet, kann das eine Titelrechtsverletzung darstellen – vor allem, wenn die Inhalte inhaltlich eng zusammenhängen (wie in meinem Fall: Der Titel der Veranstaltung lautet wie mein Buch, aus dem auch zwei Geschichten vorgelesen werden).
Häufige Irrtümer
- »Wir verdienen ja nichts daran.« – Urheberrecht gilt unabhängig vom wirtschaftlichen Zweck.
- »Es ist doch Werbung für den Autor.« – Werbung ersetzt nicht die notwendige Zustimmung.
- »Wir machen das ehrenamtlich.« – Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen haupt- und ehrenamtlicher Organisation.
- »Niemand hat sich bisher beschwert.« – Das macht eine Nutzung nicht legal, sondern bedeutet nur, dass es bisher niemand bemerkt oder verfolgt hat.
Mögliche Konsequenzen
Wer ohne Genehmigung vorliest oder den Titel eines Werkes nutzt, riskiert:
- Unterlassungsanspruch – die Veranstaltung muss geändert oder abgesagt werden
- Schadensersatz – meist berechnet nach der sogenannten Lizenzanalogie (übliche Lizenzgebühr + ggf. Verletzerzuschlag)
- Erstattung von Anwaltskosten bei berechtigter Abmahnung
Praxistipps für Veranstalter
- rechtzeitig Genehmigung einholen – am besten schriftlich.
- alle Ankündigungen korrekt beschriften – Name des Autors + vollständiger Werktitel.
- bei Unsicherheit Rat einholen – z. B. bei Verlagen oder Fachanwälten für Urheberrecht.
- Titel überprüfen – um unzulässige Titelübernahmen zu vermeiden.
Fazit
Öffentliche Lesungen sind eine wunderbare Form, Literatur zu teilen – aber sie sind kein rechtsfreier Raum. Wer sich vorher um Genehmigungen kümmert, schützt nicht nur sich selbst vor rechtlichen Folgen, sondern zeigt auch Respekt gegenüber denjenigen, die die Texte geschrieben haben.
Merkblatt für öffentliche Lesungen als PDF zum Download.
*Ich habe den Veranstalter angeschrieben und auf die juristische Sachlage aufmerksam gemacht. Daraufhin bekam ich eine E-Mail, in der mir mitgeteilt wurde, dass:
- diese Veranstaltung seit Jahren durchgeführt werde und sich noch nie ein Autor beschwert habe.
Das heißt im Klartext, dass regelmäßig Lesungen veranstaltet werden – ohne Genehmigung der Autoren. - bedauert werde, dass ich mich in meinen Autorenrechten beeinträchtigt sähe.
Das heißt für mein Verständnis: Der Veranstalter meint ganz offensichtlich, ich sei zu empfindlich.
Ich finde ein derartiges Vorgehen dreist und die Sichtweise dahinter respektlos!
Erschwerend kommt in diesem speziellen Fall hinzu, dass das Veranstalter-Gremium und die Vorleser aus Kulturschaffenden bestehen. Also aus Zeitgenossen, die eigentlich wissen sollten, was Urheberrecht bedeutet und warum es eingeführt wurde: um geistiges Eigentum zu schützen.



