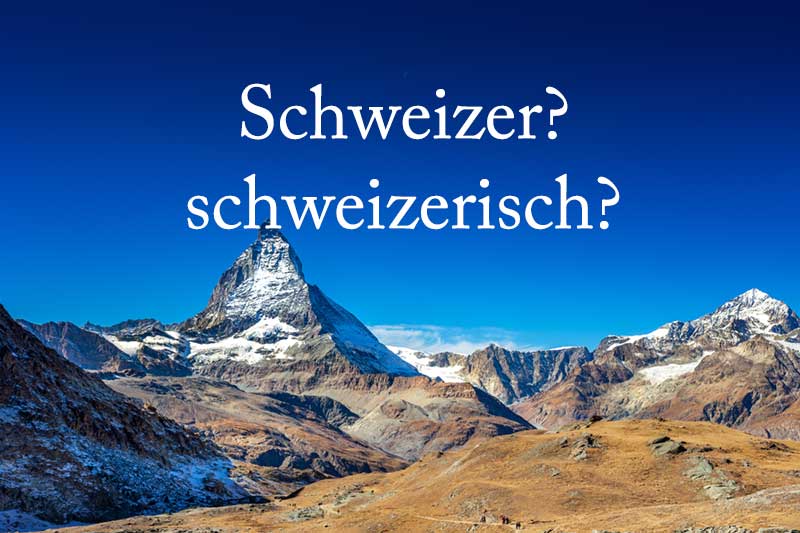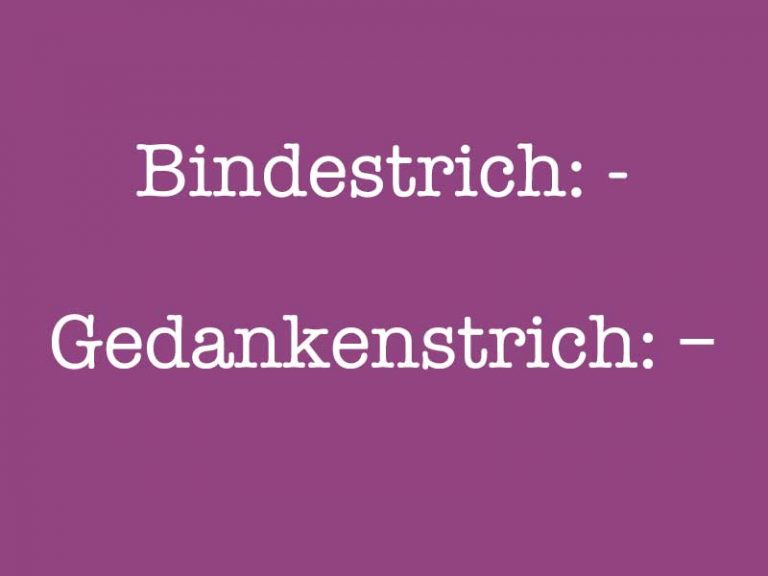Ein Schweizer Dichter? Oder ein schweizerischer Dichter?
Antwort vorab: Beides ist richtig
Über die deutschen Rechtschreibregeln wundere ich mich immer wieder, so auch heute. Ich korrigiere zur Zeit (diese beiden Wörter sollte eigentlich zusammengeschrieben werden: »zurzeit«. Ich weigere mich aber, in meinen privaten Texten eine Regel zu befolgen, die ich für unlogisch halte) ein Manuskript und bin an einer Textstelle hängengeblieben. Der Autor erwähnt dort einen Dichter, der in der Schweiz lebt, also einen »Schweizer Dichter«.
Und genau darüber bin ich gestolpert – über den groß geschriebenen Schweizer. Dass man einen Einwohner der Schweiz als Schweizer bezeichnet, weiß ich. Einen Einwohner von Deutschland bezeichnet man als Deutschen, einen Einwohner von Frankreich bezeichnet man als Franzosen und einen aus Italien als Italiener.
Demzufolge schreibt man:
– deutscher Dichter
– französischer Dichter
– italienischer Dichter
Aber: Man sagt/schreibt: Schweizer Dichter
Allerdings kann man auch sagen/schreiben: schweizerischer Dichter
Aber warum sagt/schreibt man dann »Schweizer Dichter«? So lautet nämlich der allgemein übliche Begriff, wenn ein Mensch gemeint ist, der in der Schweiz lebt und Autor ist.
Ich habe im Internet gesucht und gesucht. Einige Informationen habe ich zwar gefunden, nämlich, dass man entweder »Schweizer« oder »schweizerisch« schreibt (was ich bereits wusste), aber eine Erklärung dafür blieb mir verborgen.
Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die so leicht aufgeben, wenn sie keine Antwort auf eine (wichtige) Frage finden. Deshalb habe ich weiter gesucht, und im Grammatikportal der Justus-Liebig-Universität Giessen wurde ich schließlich fündig.
Dort steht:
»Hinsichtlich der Bedeutung besteht wohl kein Unterschied zwischen den beiden Adjektiven Schweizer und schweizerisch, aber es gibt grammatische Unterschiede. So geht dem Wahrig-Band „Fehlerfreies und gutes Deutsch“ zufolge das Adjektiv Schweizer auf die Bezeichnung der Einwohner der Schweiz zurück, genauer gesagt auf den Genitiv Plural. Demnach ist Schweizer Käse also im Grunde der Schweizer Käse bzw. Käse der Schweizer. Schweizer wird immer groß geschrieben und kommt nur in dieser Form vor, d. h. es ist unflektierbar (undeklinierbar). Darüber hinaus kommt es nur attributiv vor, d. h. es tritt immer zu einem Substantiv hinzu, das es näher beschreibt.
Schweizerisch ist dagegen wesentlich vielseitiger: Als ’normales‘ Adjektiv ist es flektierbar und kann alle adjektivtypischen Funktionen übernehmen. Das sind neben der attributiven Funktion die adverbiale Funktion […] und die prädikative Funktion. […]
Eine genaue Regel, wann welches Adjektiv verwendet wird, scheint es nicht zu geben. Die These, dass Schweizer eher im Zusammenhang mit festen Institutionen oder typischen Kulturgütern verwendet wird, erscheint angesichts solcher Zusammensetzungen wie Schweizerische Post, Schweizerische Bundesbahnen oder Schweizerisches Rotes Kreuz wenig plausibel. Die allgemeine Tendenz geht zwar zu Schweizer hin, letztlich kann aber eine Suchmaschine (z. B. Google) Auskunft darüber geben, welche der beiden Varianten im konkreten Fall die gebräuchlichere ist. So zeigt Google für „Schweizer Käse“ ca. 65.500 Fundstellen an, für „schweizerischer Käse“ dagegen nur ca. 263.
So verhält sich das also mit dem »Schweizer« …